Eine klimaneutrale Wärmeversorgung für Brauereien

Emissionsfreie Wärmeversorgung für Brauereien
Brauereien sind in der Lebensmittelindustrie erhebliche Energieverbraucher. Ein bedeutender Anteil dieser Energie – etwa 60 bis 75 % – wird für Prozesswärme verwendet, die nach wie vor überwiegend aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird.1
Im Zuge der Umstellung der Branche auf Nachhaltigkeit bietet die Elektrifizierung in Kombination mit thermischer Energiespeicherung einen vielversprechenden Weg zur Dekarbonisierung. Dieser Ansatz reduziert nicht nur die Emissionen, sondern verbessert auch die Kosteneffizienz und die Energieunabhängigkeit.
Energiebedarf im Brauereisektor
Je nach Effizienz der Anlage liegt der durchschnittliche Energiebedarf für den gesamten Brauprozess bei etwa 40 kWh pro Hektoliter. Das bedeutet, dass große globale Produzenten leicht mehrere Terawattstunden Energie pro Jahr verbrauchen können.

Zur Veranschaulichung:
- Die Niederlande produzieren etwa 25 Millionen Hektoliter pro Jahr.
- Heineken, dessen weltweite Produktion die der USA übersteigt, hat wahrscheinlich einen jährlichen Energiebedarf von etwa 9.700 GWh, der aufgrund fortschrittlicher Effizienzmaßnahmen möglicherweise noch niedriger ist.
- Anheuser-Busch InBev, der weltweit größte Bierhersteller, produzierte 2023 über 500 Millionen Hektoliter, mit einem potenziellen Energiebedarf von bis zu 19 TWh pro Jahr.
Prozessschritte mit hohem Wärmebedarf beim Brauen
Das Brauen von Bier ist ein langwieriger Prozess, der die Beschaffung von Malz und Hopfen, das Trocknen und Mahlen der Zutaten, das Maischen, Läutern, Kochen, Gären und Reifen sowie aufwendige Filtrations- und Abfüllprozesse umfasst.
Einige dieser Schritte werden bei Raumtemperatur oder gekühlten Temperaturen durchgeführt. Zu den wärmeintensiven Prozessen gehören:
- Malztrocknung (Darren): ~50–75 °C
- Maischen: 40–78 °C
- Läutern: 76–78 °C
- Würzekochen: ~100 °C
- Pasteurisierung: 60–72 °C vor der Abfüllung
- Sterilisation der Flaschen: 60–135 °C
Diese Schritte machen den größten Teil des Wärmeenergieverbrauchs in einer Brauerei aus. Der Energieanteil variiert stark je nach Prozess, wobei das Würzekochen am intensivsten ist.

Dampf als zentrale Grundlage der Wärmeübertragung
Die meisten Brauereien sind auf zentrale Dampfnetze angewiesen, die mit 8–14 bar und 175–195 °C betrieben werden7,8. Dampf ist effizient, leicht zu regulieren und ideal für die Beheizung mehrerer Prozessschritte.6 Allerdings können aktuelle industrielle Wärmepumpen diese Temperaturen nicht effektiv erreichen.
Die Transformation sollte sich daher weniger auf den Ersatz einzelner Heizsysteme konzentrieren, sondern vielmehr auf die Bereitstellung von grünem Dampf für die bestehende Infrastruktur. Dieser kann durch direkte elektrische Dampfkessel bereitgestellt werden, die effizient und eine gute Lösung sind. Angesichts des Marktes für erneuerbare Energien ist jedoch Flexibilität der Schlüssel zur Senkung der Strompreise, sodass für die beste OPEX-Lösung eine thermische Energiespeicherung erforderlich ist.
Die Rolle von Kraftblock: Dekarbonisierung von Prozesswärme
Die Strompreise sinken, wenn erneuerbare Energien viel Strom erzeugen, beispielsweise mittags durch Photovoltaik oder nachts durch Windkraft. Um diese Energie den ganzen Tag über nutzen zu können, kann sie mit einem thermischen Energiespeicher wie Kraftblock transportiert werden. In Kombination mit einem Dampferzeuger kann diese Infrastruktur genutzt werden, um Dampf aus erneuerbaren Quellen zu deutlich geringeren Stromkosten zu erzeugen.
Dieser Ansatz ermöglicht Brauereien:
- CO₂-Emissionen zu reduzieren,
- Betriebskosten (OPEX) zu senken,
- Strom dann zu nutzen, wenn er am günstigsten ist,
- ihre Energiesysteme zukunftssicher zu machen, ohne die bestehende Dampfinfrastruktur zu überholen.
Praxisbeispiel: PepsiCo & Eneco in den Niederlanden
Ein vergleichbares Konzept wird bereits in den Niederlanden umgesetzt:
Im Rahmen des „Volt”-Projekts des Renewable Energy Solutions Programme setzen PepsiCo und Eneco das Wärmespeichersystem von Kraftblock ein, um einen fossilen Gasboiler zu ersetzen, der zuvor zur Erhitzung von Thermalöl für die Frittierung von Kartoffelchips verwendet wurde. Durch die flexible Beschaffung von Strom und dessen Speicherung als hochdichte Wärme ermöglicht das Projekt eine kosteneffiziente, fossilfreie Produktion und zeigt eine skalierbare Lösung, die direkt auf wärmeintensive Branchen wie die Brauindustrie übertragbar ist.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Dieses Projekt wird im Zuge des Renewable-Energy-Solutions-Programms der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert.
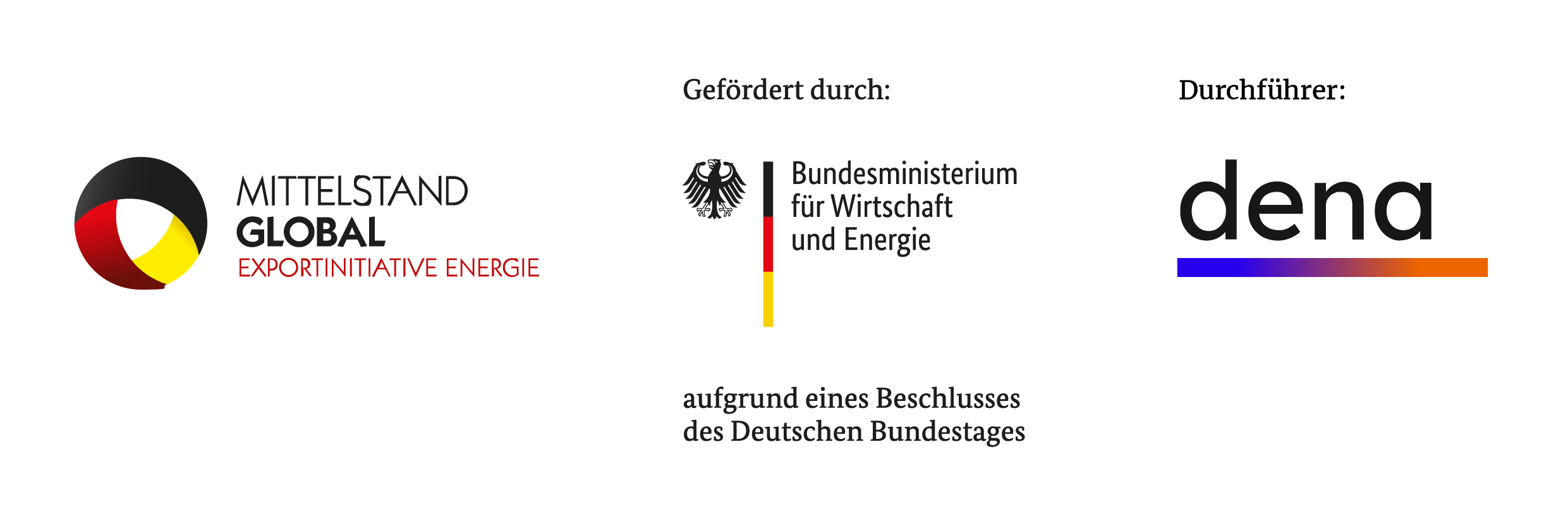
Quellen
1) Bär, Raik & Voigt, Tobias. (2019). Analysis and Prediction Methods for Energy Efficiency and Media Demand in the Beverage Industry. Food Engineering Reviews. DOI:10.1007/s12393-019-09195-y
2) Worrel, Ernst; Galitsky, Christina & Martin, Nathan (2002): Energy Efficiency Opportunities in the Brewery Industry. Online: https://www.osti.gov/servlets/purl/881595
3) Steam Industry EU: Bottling lines: How to clean and disinfect glass bottles? Online: https://www.stindustry.eu/en/how-to-clean-and-disinfect-glass-bottles/#:~:text=Deep%20cleaning%20and%20sanitising%20action,line%20and%20even%20glass%20bottles
4) americancraftbeer.com: World’s biggest beer producer in 2024. Online: https://www.americancraftbeer.com/worlds-biggest-beer-producers-in-2024/
5) Anton Paar: Beer brewing process. Online: https://wiki.anton-paar.com/en/beer-brewing-process/
6) Brücklmeier, Jan (2022): Energieeinsatz in der Brauerei. Braumagazin, online: https://braumagazin.de/article/energieeinsatz-in-der-brauerei
7) Hagelschuer (2024): Hagelschuer lieferte Dampfkesselanlage an die Schumacher Brauerei in Düsseldorf. Online: https://www.dampfkessel.com/projekt-des-monats-november-2024/
8) Göbelbäcker, Jona (2020): Installation einer Biomasse-Dampfkesselanlage für die Brauerei Carlsberg. Online: https://www.pharma-food.de/utilities-services/installation-einer-biomasse-dampfkesselanlage-fuer-die-brauerei-carlsberg.html
